26. April 2025
Episode 2:
Wölfe und Hunde im Vergleich:
Wer ist sozialer?
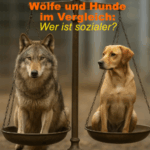
Inhaltsangabe
Sind Hunde durch ihr enges Zusammenleben mit uns Menschen die „sozialeren“ Tiere? Oder steckt im Wolf, ihrem kooperativen Vorfahren, vielleicht mehr Großzügigkeit? In dieser Folge von „art gehört“ tauchen Massimo und Petra tief in die faszinierende Welt des prosozialen Verhaltens ein. Wir beleuchten eine spannende Studie
Erfahren Sie mehr über ein cleveres Experiment mit einem Touchscreen
Begleiten Sie uns auf eine erkenntnisreiche Reise in die Verhaltensforschung und entdecken Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Wolf und Hund aus einer neuen Perspektive.
Quellen & Verweise
Dieser Podcast beruht auf der Publikation Wolves, but not dogs, are prosocial in a touch screen task der Autorinnen Rachel Dale, Sylvain Palma-Jacinto, Friederike Range & Sarah Marshall-Pescini aus dem Jahr 2019.
Mehr über die Forschung am Wolf Science Center
Transkript
Massimo: Herzlich willkommen zu „art gehört“, dem Podcast von LebensArt mit Hunden, präsentiert vom Verein LebensArt Mensch Tier Natur. Mein Name ist Massimo.
Petra: Und ich bin Petra. Schön, dass Sie wieder dabei sind! Heute haben wir ein unglaublich spannendes Thema im Gepäck, das uns tief in die Psyche unserer vierbeinigen Begleiter und ihrer wilden Verwandten blicken lässt. Es geht um prosoziales Verhalten – also darum, freiwillig etwas zu tun, das einem anderen hilft oder nützt.
Massimo: Genau, Petra! Und die zentrale Frage, die uns heute beschäftigt, stammt aus einer faszinierenden Studie von Rachel Dale und Kollegen vom Wolf Science Center in Österreich: Sind Wölfe prosozialer als Hunde? Der Titel der heutigen Episode könnte also auch lauten: „Ist geben seliger denn Nehmen? Wölfe und Hunde im Prosozialitäts-Test“.
Petra: Das klingt ja erstmal kontraintuitiv, Massimo! Man würde doch denken, dass Hunde durch die Domestikation und das enge Zusammenleben mit uns Menschen gelernt haben, besonders sozial und kooperativ zu sein, vielleicht sogar mehr als Wölfe. Es gibt ja auch Domestikationshypothesen, die genau das nahelegen – dass Hunde für höhere Toleranz und Kooperationsfähigkeit selektiert wurden.
Massimo: Das ist richtig, das ist eine gängige Annahme. Aber es gibt eben auch eine andere Perspektive. Wölfe leben in hochkooperativen Rudeln. Sie jagen gemeinsam, ziehen ihre Jungen gemeinsam auf und verteidigen ihr Territorium zusammen. Diese starke Abhängigkeit von Kooperation könnte dazu geführt haben, dass Wölfe besonders ausgeprägte prosoziale Fähigkeiten entwickelt haben – also die Neigung, anderen Rudelmitgliedern zu helfen, auch wenn es ihnen selbst nicht direkt etwas bringt. Man nennt das auch die Sozioökologie- oder die Kooperative-Aufzucht-Hypothese.
Petra: Ah, verstehe. Also zwei gegensätzliche Vorhersagen: Die Domestikationshypothese sagt, Hunde sollten prosozialer sein, während die Kooperationshypothesen eher auf die Wölfe setzen. Und genau das wollten die Forscher herausfinden! Wie sind sie da vorgegangen?
Massimo: Sie haben einen wirklich cleveren Versuchsaufbau mit einem Touchscreen verwendet, um sowohl Wölfe als auch Hunde zu testen, die unter identischen Bedingungen im Wolf Science Center aufgewachsen sind und leben. Das ist wichtig für den direkten Vergleich. Neun Wölfe und sechs Hunde nahmen teil. Der Test funktionierte so: Ein Tier – der „Geber“ – befand sich vor einem Touchscreen. Auf dem Bildschirm erschienen zwei Symbole.
Petra: Okay, und was passierte, wenn der Geber eines der Symbole berührte?
Massimo: Wenn der Geber das „Gebende Symbol“ mit der Nase berührte, wurde eine Futterbelohnung in ein angrenzendes Gehege gegeben. Wenn er das „Kontrollsymbol“ berührte, passierte gar nichts – keine Belohnung für niemanden. Der Geber selbst bekam in beiden Fällen während des Tests keine Belohnung.
Petra: Moment mal, der Geber ging selbst leer aus? Warum sollte er dann überhaupt das gebende Symbol drücken? Das klingt ja nicht sehr motivierend.
Massimo: Genau das ist der Kern der Prosozialität! Tust du etwas Gutes für einen anderen, auch wenn du selbst nichts davon hast? Um sicherzustellen, dass die Tiere den Zusammenhang verstanden hatten, gab es eine Trainingsphase. In dieser Phase war die Tür zum Nachbargehege offen, und der Geber konnte sich die Belohnung nach dem Drücken des gebenden Symbols selbst holen. Erst im eigentlichen Test war die Tür dann geschlossen.
Petra: Okay, das macht Sinn. Der Geber wusste also, was passiert, wenn er das gebende Symbol drückt. Und wer war dann im Nachbargehege während des Tests?
Massimo: Das war der Clou. Es gab verschiedene Bedingungen. In der eigentlichen Testbedingung saß ein Partner im Nachbargehege und konnte die Belohnung fressen, die der Geber auslöste. Und hier wurde nochmal unterschieden: Mal war der Partner ein bekanntes Mitglied aus dem eigenen Rudel – ein sogenannter „In-Group“-Partner. Mal war es ein bekanntes Tier aus einem anderen Rudel – ein „Out-Group“-Partner.
Petra: Interessant! So konnte man also testen, ob die Beziehung zum Partner eine Rolle spielt. Gibt man eher einem Freund etwas oder auch einem Bekannten von nebenan?
Massimo: Ganz genau. Und dann gab es noch Kontrollbedingungen, um sicherzustellen, dass das Verhalten wirklich prosozial war. Zum Beispiel die „Soziale-Fazilitations-Kontrolle“: Hier war der Partner zwar anwesend, aber in einem anderen Bereich, wo er das Futter nicht erreichen konnte. So konnte man ausschließen, dass der Geber nur deshalb öfter drückt, weil einfach ein Artgenosse da ist. Und es gab auch eine nicht-soziale Kontrolle ganz ohne Partner.
Petra: Puh, ein ziemlich ausgeklügeltes Design! Und was kam nun raus? Wer war der großzügigere Geber – Wolf oder Hund? Ich bin gespannt!
Massimo: Trommelwirbel… Die Wölfe! Die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig. Die Wölfe drückten signifikant häufiger das gebende Symbol, wenn ein Partner aus dem eigenen Rudel (In-Group) im Nachbargehege saß und das Futter bekommen konnte, verglichen mit der Kontrollbedingung, wo der gleiche Partner anwesend war, aber keinen Zugang zum Futter hatte. Sie gaben also aktiv Futter an ihre Rudelmitglieder.
Petra: Wow! Das bestätigt also die Hypothese, dass die kooperative Lebensweise der Wölfe mit prosozialem Verhalten zusammenhängt. Und wie sah es bei den Hunden aus? Haben die auch gegeben?
Massimo: Nein, überraschenderweise zeigten die Hunde in diesem Experiment kein solches prosoziales Verhalten. Es machte für sie keinen Unterschied, ob ein Partner Futter bekam oder nicht. Sie drückten nicht häufiger das gebende Symbol, wenn der Partner davon profitierte. Tatsächlich schienen sie über die Testsitzungen hinweg eher die Motivation zu verlieren, überhaupt zu drücken, solange sie nicht selbst belohnt wurden.
Petra: Das ist wirklich erstaunlich! Hunde, die wir oft als so sozial wahrnehmen, zeigen hier weniger Großzügigkeit als Wölfe. Aber lag es vielleicht daran, dass die Hunde die Aufgabe nicht verstanden haben oder gestresst waren?
Massimo: Das konnten die Forscher ausschließen. Beide, Wölfe und Hunde, lernten die Aufgabe im Training ähnlich schnell. Und ganz wichtig: Am Ende jeder Testsitzung gab es sogenannte „Wissens-Probe-Trials“, bei denen der Geber plötzlich doch wieder selbst Futter bekam, wenn er das gebende Symbol drückte. Und da machten alle Tiere sofort wieder mit! Das zeigt, sie waren nicht gestresst oder abgelenkt, sondern hatten einfach keine Motivation zu geben, wenn sie selbst nichts davon hatten – zumindest die Hunde.
Petra: Verstehe. Und was war mit den Partnern aus dem fremden Rudel, den Out-Group-Partnern? Haben die Wölfe denen auch Futter gegeben?
Massimo: Interessanterweise nicht. Die Wölfe zeigten keine prosoziale Tendenz gegenüber den Out-Group-Partnern. Sie drückten für sie nicht häufiger das gebende Symbol als in der Kontrollbedingung. Das unterstreicht, wie wichtig die soziale Beziehung und die Gruppenzugehörigkeit für prosoziales Verhalten bei Wölfen ist. Man hilft vor allem den eigenen Leuten – dem eigenen Rudel.
Petra: Das passt ja wieder gut zur Idee, dass Prosozialität die Kooperation innerhalb der Gruppe stärkt. Aber wie erklären die Forscher nun, warum die Hunde in diesem Versuch nicht prosozial waren? Andere Studien mit Haushunden haben ja durchaus prosoziales Verhalten gefunden.
Massimo: Das ist ein wichtiger Punkt. Die Forscher sind da vorsichtig. Es könnte an methodischen Unterschieden zwischen den Studien liegen. Vielleicht spielt auch die Sozialisation eine Rolle: Haushunde werden von uns Menschen ja oft dazu erzogen oder ermutigt, tolerant gegenüber anderen Hunden zu sein, während die Hunde im Wolf Science Center ohne solche direkten Eingriffe aufwachsen. Es ist also möglich, dass Haushunde durch Training und Erfahrung prosozialer werden als diese speziellen Rudelhunde.
Petra: Das leuchtet ein. Aber das zentrale Ergebnis dieser Studie bleibt ja bestehen: Wenn man Wölfe und Hunde unter exakt gleichen Bedingungen testet, zeigen die Wölfe mehr prosoziales Verhalten gegenüber ihren Rudelmitgliedern.
Massimo: Absolut! Und das stützt stark die Annahme, dass die Notwendigkeit zur Kooperation in der komplexen sozialen Welt der Wölfe ein wichtiger Motor für die Entwicklung von Prosozialität war. Es scheint, dass die Domestikation diese spezielle Form der freiwilligen Großzügigkeit bei Hunden möglicherweise nicht im gleichen Maße gefördert hat, vielleicht weil ihr Überleben weniger von komplexer Gruppenkooperation abhing als das der Wölfe. Prosoziales Verhalten bei Hunden könnte also eher ein Erbe ihrer Wolfsvorfahren sein, das je nach Lebensumständen und vielleicht auch Testmethode mal mehr, mal weniger zum Vorschein kommt.
Petra: Eine wirklich faszinierende Studie, die unser Bild vom „sozialen Hund“ und dem „wilden Wolf“ doch ein wenig zurechtrückt. Es zeigt, wie wichtig es ist, Verhalten im Kontext der jeweiligen Ökologie und Sozialstruktur der Art zu betrachten.
Massimo: Absolut. Und es erinnert uns daran, dass Wölfe unglaublich soziale und kooperative Tiere sind, deren Verhalten vielleicht die Grundlage für vieles gelegt hat, was wir heute an unseren Hunden schätzen. Damit sind wir aber auch schon am Ende unserer heutigen Folge von „art gehört“. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Stoff zum Nachdenken gegeben wie uns – Vielen Dank an dich, liebe Petra – Wir plaudern dann bei der nächsten Folge wieder miteinander!
Petra: Genau! Danke für’s dabeisein und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns die nächste spannende Studie gemeinsam vornehmen. Tschüss Massimo und bis bald liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!
